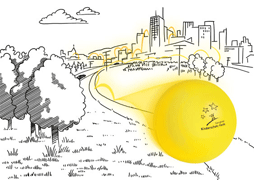Folge 4:
Andreas Hilliger, Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg.
Die Architektur der Jugendhilfepolitik und damit auch die Kinderschutzarbeit im Land Brandenburg tragen maßgeblich seine Handschrift. Andreas Hilliger selbst würde es wahrscheinlich nie so formulieren wollen, aber in Fachkreisen herrscht dazu großer Konsens. – Die Karriere des studierten Erziehungswissenschaftlers begann Anfang der achtziger Jahre. Damals wechselte er nach einer kurzen Stippvisite in der heilpädagogischen Heimerziehung zur Berliner Jugendverwaltung. Heute ist er als Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg (MBJS) für das breite Aufgabengebiet Kinder, Jugend Sport Weiterbildung und Schulträgerangelegenheiten zuständig. An seinen ersten Arbeitstag im MBJS erinnert er sich noch genau: 6. Dezember 1990, Nikolaustag. Andreas Hilliger ist verheiratet und hat vier Kinder. Das jüngste Kind ist 13 Jahre alt.
Herr Hilliger, in der letzten Folge hat sich Prof. Dr. Knösel, Dekan an der FH Potsdam, sehr positiv über Ihr Wirken innerhalb der brandenburgischen Jugendhilfelandschaft geäußert. Er hatte aber auch eine kritische Frage an Sie, wenngleich er diese mit einem gewissen Augenzwinkern formulierte: „Demnächst kommt ja das Geld vom Bund aus der Bundesinitiative Frühe Hilfen. Meine Bitte wäre: Herr Hilliger, vergessen sie dabei nicht die Familienhebammen und einen breiten Ansatz. Warum muss Brandenburg immer so sparen? Kann das Land nicht einmal über seinen finanziellen Schatten springen?“
Das könnten wir, natürlich. Vorausgesetzt, wir wüssten, wo wir das Geld hernehmen. Wahrscheinlich wäre Herr Knösel nicht damit einverstanden, wenn wir vorschlagen, das Geld bei den Hochschulen zu kürzen. (lacht) – Herzlichen Dank für die positiven Worte, die nicht nur mir gelten, sondern dem was wir sowohl von Landesseite als auch auf kommunaler Ebene, von Jugendamtsseite im Bereich Kinderschutz leisten. Über solche Rückmeldungen freut man sich natürlich. – Die Familienhebammen werden wir unterstützen. Das steht außer Frage. Denn das Konzept, die gesundheitlichen Hilfen der Hebammen als Anknüpfungspunkt für sozialpädagogische Angebote zu nehmen, ist vernünftig. Das ist ein guter Ansatz, um junge Mütter und Väter frühzeitig, direkt nach der Geburt in der Wahrnehmung ihrer Elternrolle zu stärken. Doch die Bundesmittel, die aus der Bundesinitiative dafür zur Verfügung stehen, sind sehr begrenzt und ein flächendeckendes Angebot an Familienhebammen wird damit nicht zu realisieren sein. Deshalb werden wir gemeinsam mit den Jugendämtern sehr genau überlegen, wie die Mittel eingesetzt werden. Was wir von Landesseite machen werden, ist eine Qualifizierung zur Familienhebamme. Das Angebot richtet sich an Hebammen wie auch an andere Fachkräfte, die Erfahrung in der Arbeit mit Familien mit sehr jungen Kindern haben. Die Ausbildung soll also zwei Seiten umfassen: zum einem die pädagogische Kompetenz, die bei medizinischen Berufen eine Rolle spielt und zum anderen die medizinische Kompetenz, die man bei pädagogischen Berufen haben muss, wenn man mit sehr jungen Familien arbeitet.
Welcher aktuellen Entwicklung im Kinderschutz messen Sie besondere Bedeutung zu?
Die Diskussion im Kinderschutz bewegt sich immer zwischen den beiden Polen Prävention und Intervention. Wir in Brandenburg haben – nach meinem Eindruck etwas stärker als andere Länder – die Weiterentwicklung der Interventionskompetenz in den Fokus genommen. Möglicherweise ist da bei einigen Akteuren auf Bundesebene der Eindruck entstanden, dass wir im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport nicht primär auf präventive Projekte setzen. Die Beobachtung ist sicher nicht ganz falsch. Wir – auch ich – waren zum einen geprägt von den schlimmen Misshandlungs- und Tötungsfällen, aber auch etwas zögerlich wegen der Sorge, dass Prävention als leichter Ausweg erscheinen könnte, um den Schwierigkeiten im Umgang mit den harten Fällen auszuweichen. Doch diese „Kind-in-Not-Situation“ muss bei der Diskussion um den Kinderschutz immer mit bedacht werden. Die löst sich nicht auf, da kann der Präventionsschwerpunkt noch so gut ausgebaut sein. Damit nicht der Eindruck entsteht, die Prävention wurde bisher vernachlässigt: Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Frauen hat mit den Netzwerken Gesunde Kinder, in deren Rahmen Ehrenamtliche Kräfte junge Familien unterstützen einen sehr interessanten allgemeinpräventiven Ansatzpunkt entwickelt.
Wie soll das konkret aussehen?
Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt unmittelbar Landesprogramme auflegen werden. Das werden wir wahrscheinlich nicht. Wir haben im Landesjugendplan keinen Spielraum, die präventive Kinderschutzarbeit vor Ort stärker zu fördern. Wir bleiben auch hier bei dem Grundsatz, dass das Land Aktionen in den Kreisen und kreisfreien Städten mit übergreifenden Themen unterstützt: über Empfehlungen, Beratung, Begleitung und Fortbildung. Die Arbeit vor Ort muss von den Akteuren, die dafür zuständig sind, finanziert werden. Das sind die Jugendämter. Die Bundesinitiative bietet jedoch eine gute Chance, die existierenden Netzwerke für Kinderschutz auch hinsichtlich präventiver Aspekte und allgemeiner Familienunterstützung weiterzuentwickeln. So werden wir die Landesempfehlungen zur Zusammenarbeit im Kinderschutz überarbeiten und darin auch präventive Ansätze deutlicher machen. Es ist dann zum Beispiel zu überlegen, wer in den regionalen Arbeitsgruppen noch zusätzlich an Bord kommt, z. B. die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen oder die auf ehrenamtlicher Arbeit aufbauenden Netzwerke Gesunde Kinder.
Gibt es dafür einen Zeitplan?
Mit der Überarbeitung der Landesempfehlungen wollen wir noch in diesem Jahr beginnen. Bei der ersten Auflage in 2006 hat der Abstimmungsprozess gut ein dreiviertel Jahr gedauert. Auch dieses Mal werden wir die kommunale Ebene einbeziehen ebenso wie die anderen im Kinderschutz beteiligten Häuser, also Soziales, Gesundheit, Justiz, Polizei. Interessant an der gegenwärtigen Diskussion ist der Schwerpunkt, zu dem sie geführt wird: Jetzt werden Kinderschutzfragen insbesondere gesundheitspolitisch thematisiert, während die Fragen zu Polizei und Justiz, die uns vor zehn Jahren intensiv beschäftigt haben, in den Hintergrund rücken.
Was war ein wichtiges Ereignis oder Erlebnis in Ihrem Leben, privat oder beruflich?
Da gibt es einige… Im Bereich Kinderschutz war ein wichtiges Erlebnis sicher das im Sommer 2005, als die Tötungsdelikte an den neun Babys bekannt geworden sind. Es gab damals die Aufforderung aus dem Kabinett, wir müssen da was machen. Meine damalige Kollegin aus dem Gesundheitsministerium und ich haben uns dann direkt auf den Weg nach Brieskow-Finkenheerd gemacht. Vor Ort haben wir das Erschrecken und die Hilflosigkeit beim Umgang mit einem so monströsen Ereignis unmittelbar erfahren, In Gesprächen mit den Einsatzkräften, Nachbarn, dem Bürgermeister und der Familie. Das kann man nicht vergessen. Eindrücklich bleibt mir auch der Tod von Dennis in Cottbus in Erinnerung, der eine lange Zeit in einer Kühltruhe – ja, man muss sagen – „beerdigt“ war. Zu diesem Fall hatte ich damals zusammen mit einem Kollegen aus dem Schulbereich die Verwaltungsabläufe und Handlungen der beteiligten öffentlichen Stellen rekonstruiert. Beide Fälle waren zwei sehr einschneidende Erfahrungen, die mich, auch wenn sie schon fast zehn Jahre zurückliegen, heute noch stark berühren.
Sie beschreiben das Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit. Wie sind Sie persönlich damit umgegangen?
Bei aller Betroffenheit muss man fragen: Was kann man tun? Das war für uns auch ein Motiv, im Jahr 2006 – als eine der ersten Landesregierungen – ein Programm zum Kinderschutz aufzulegen. Diese Initiative war nicht allein durch meine persönliche Betroffenheit bedingt, sondern vor allem auch durch das hohe öffentliche Interesse. Ich habe den Eindruck, dass es dadurch, dass wir das Programm von Beginn an relativ klar auf Dauer und nicht nur als Strohfeuer angelegt hatten, auch eine intensivere Fachdiskussion möglich wurde. Wir konnten deutlich machen, dass es Wege gibt, etwas gegen Gewalt gegen Kinder zu unternehmen. Man muss schreckliche Fälle nicht verdrängen, man kann damit umgehen! Dies gilt für alle, die Wahrnehmungen bezogen auf mögliche Kinderschutzfälle haben. Unser Programm hat dazu beigetragen, dass es heute einen anderen Umgang mit Hochrisikofällen gibt und die Wahrnehmung geschärft ist. Das bietet letztendlich auch einen guten Schutz. Jedoch, es wird nie ganz zu verhindern sein, dass Kinder in ihren Familien zu Tode kommen – kein Kinderschutz-Programm kann diese Sicherheit bieten.
Ein Blick in die Zukunft. Was wünschen Sie sich für die Kinderschutzarbeit? Haben Sie eine Vision, die sie vielleicht noch nie jemandem erzählt haben?
Wenn wünschen helfen würde, würde ich antworten: dass keine Kinder mehr zu Tode kommen oder misshandelt werden. Aber Wünsche sollen ja realistisch bleiben. Deshalb wünsche mir erstens, dass wir die Balance halten von Aufmerksamkeit und Kontrolle bei gleichzeitiger Wahrung der Privatsphäre. Denn ich sehe eine gewisse Gefahr, dass sich die Gewichte zugunsten eines unangemessenen Eingriffs in Familien verschieben. „Warum hat man denen nicht die Kinder weggenommen?“ Solche und ähnliche Äußerungen finden zum Teil einen ziemlich hohen Grad an Zustimmung. Ich beobachte diese Tendenz nicht so sehr in Fachkreisen, allerdings im politisch-medial vermittelten Diskurs. Zweitens wünsche ich mir, dass die Beschäftigung und die Betroffenheit mit dem Kinderschutz nicht dort aufhören, wo das Kind aus der Familie herausgenommen wurde und damit vermeintlich „gerettet“ worden ist. Denn diese Kinder brauchen in ganz besonderem Maße, aufgrund ihrer schlimmen Erfahrungen und der häufig sehr frühzeitigen Schädigungen und Erziehungsmängel ein Umfeld, in dem sie gut aufwachsen können. Die Auffassung, Kinderschutz ist das Retten der Kinder vor den Eltern, ist eine Verkürzung der Diskussion. Der Auftrag heißt vielmehr: Wir geben Kindern, die in gefährlichen Situationen waren, eine Perspektive für die nächsten zehn bis 15 Jahre, also bis sie erwachsen sind und helfen ihnen ohne ihre Eltern aufzuwachsen, sei es bei Pflegeeltern oder in einer Heimgruppe. Diese langfristige Perspektive ist mir sehr wichtig. Dass ich mein Berufsleben im heilpädagogischen Kinderheim angefangen habe, spielt dabei sicher eine Rolle.
Nächste Folge
Andreas Hilliger spielt den Gelben Ball weiter an Frauke Frehse-Sevran und ihr Team vom Kindernotdienst in Potsdam mit folgender Frage:
Wie gehen Kinder, die schwere Misshandlungserfahrungen machen mussten, mit dieser Beschädigung ihres Lebens um und wie kann man ihnen helfen?